Wie fühlt es sich an, einen Gedanken festzuhalten? Und dann zu merken (und daran mitzuwirken), wie er wächst und reift? Man nehme Stift und Papier …
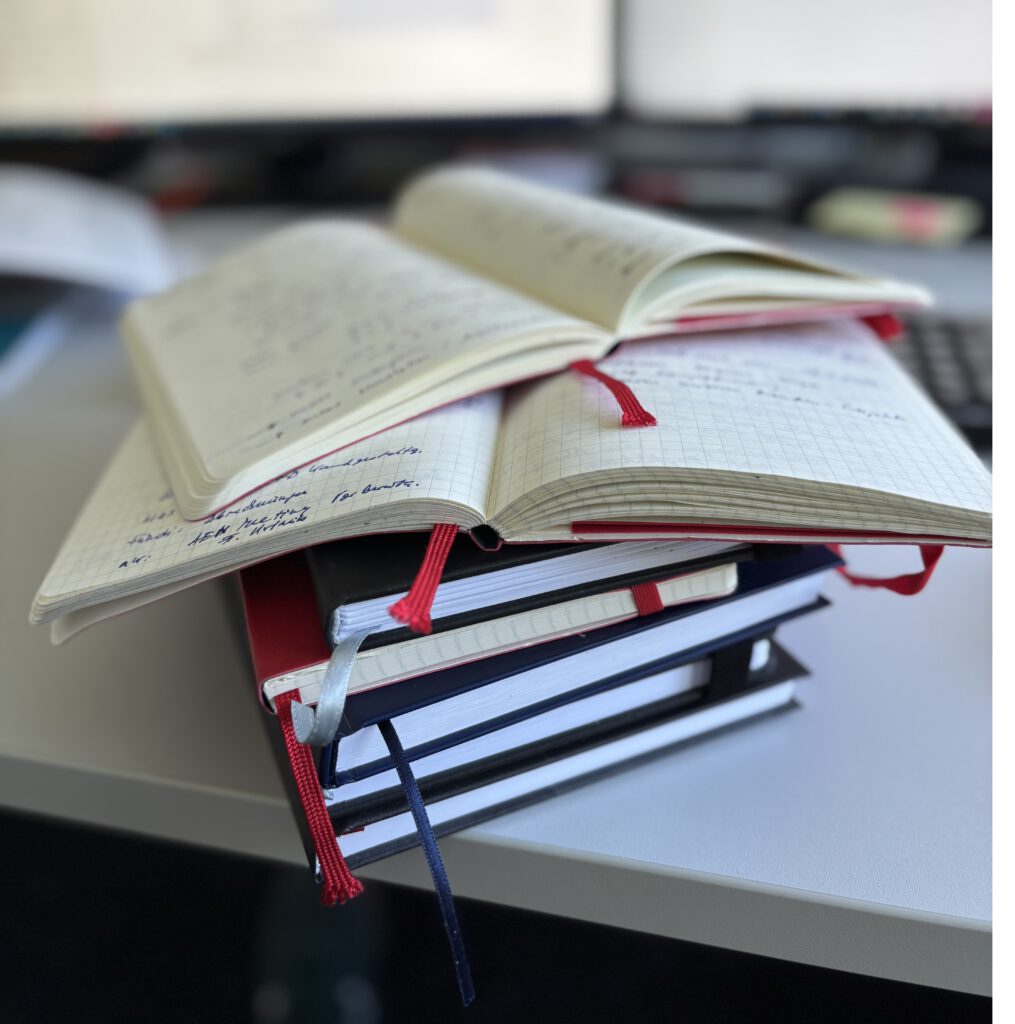
Vor ein paar Jahren, mitten im „Agil-Hype“ hörte ich den Vortrag eines „Chief Digital Officers“ aus der Industrie. Er meinte, in seiner Firma gebe es jetzt eine Selbsthilfegruppe, die sich die „anonymen Analogiker“ nenne. Das seien die Typen, die immer noch mit Stift und papiernem Notizbuch ins Meeting kommen.
Ein augenzwinkernder Joke, aber ich fühlte mich ertappt – und als potenzieller „Ewiggestriger“ missverstanden. Erschrocken legte gleich meinen Schreibblock beiseite. In den Wochen darauf versuchte ich dann, etwas „digitaler“ zu sein. Ich erschien mit aufgeklapptem Laptop im Meeting, tippte schon während eines Calls Notizen ins Handy, fügte Abschnitt um Abschnitt und Seite um Seite in die „OneNote“-App. Und ließ das alles irgendwann wieder bleiben.
Denn ich bin zutiefst überzeugt: Auch im digitalen Zeitalter und in agilen Projekten lässt sich beides miteinander verbinden – die handschriftliche Notiz und das digitale Dokument. Es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen: der eigene Charakter oder die eigene Biographie, ein merkwürdiges mnemotechnisches Phänomen und die (kreative) Vielfalt der Aufgabenstellungen.
Die Füller-Sammlung
Zugegeben, ich habe einen Knall. Wann immer ich schöne Schreibgeräte sehe oder einen Notizblock aus solidem Papier, möchte ich sie besitzen. Relativ oft gelingt mir das auch. Und da ich sie dann schon mal besitze, möchte ich sie auch benutzen. Ich bin sehr froh, dass sich diese Leidenschaft auf die Welt der Papeterie bezieht. Nicht auszudenken, wie es geworden wäre, hätte ich ein Faible für Waffen entwickelt. Zu meiner Liebe zum Schreibgerät eine kurze Anekdote: Im zarten Alter von 16 marschierte ich in einen Schreibwarenladen und forderte selbstbewusst, ein Montblanc Meisterstück probeschreiben zu dürfen. Ich wünschte die damals breitestmögliche Feder zu testen, gottseidank hatten sie „nur“ eine stinknormale B da. Nach ein paar Zeilen nickte ich und meinte, ich müsse nur noch zur Bank das Geld besorgen, dann käme ich zurück und würde das Stück käuflich erwerben (wir reden hier vom Jahr 1982 und von stolzen 350 D-Mark). Die Verkäuferin sah mich mitleidig an – sie hielt das für eine Notlüge, noch dazu für eine überflüssige. Ihr Gesicht sagte: „Junge, mir ist doch klar, dass Du das Geld nicht hast. Du kannst doch einfach so gehen.“
Aber ich hatte das Geld gespart, ein lukrativer Ferienjob machte es möglich. Zur völligen Verblüffung der Dame kehrte ich nach ein paar Minuten in den Laden zurück. So kam ich zu meinem ersten „Meisterstück“. Heute habe ich sechs davon. Und da es mit Pelikan, Lamy, Diplomat, Parker, Pilot, Waterman, Aurora, Visconti, OMAS, Graf-von-Faber-Castell etc. etc. noch viele weitere höchst faszinierende Füllermarken gibt, nenne ich heute circa 90 Füllhalter mein Eigen. Ein Teil von ihnen wird abwechselnd in ein kleines Ledermäppchen gepackt und so auch beruflich genutzt. Und das ist auch gut so, würde ich heute im Wowereit-Ton sehr selbstbewusst jedem Chief Digital Officer ins Gesicht sagen.
Denn mit Füller bzw. von Hand schreiben hat viele Vorzüge, auf die ich heute nicht mehr verzichten will.
Gedächtnistraining, Kreation – und Spaß
Ein klassisches Beispiel ist, dass man sich handschriftliche Notizen leichter merkt. Wie oft bin ich schon zum Supermarkt gefahren und hatte den Einkaufszettel zuhause liegen lassen. Und dennoch kehrte ich mit nahezu allen Artikeln und Produkten zurück, die ich auf dem vergessenen Zettel notiert hatte. Ein rätselhafter, aber intakter mnemotechnischer Effekt: was man notiert, findet leichter ins Gedächtnis – und das auch bei komplexeren Angelegenheiten als einem Einkaufszettel, beispielsweise bei einer Gliederung für einen Vortrag, den man frei halten will.
Außerdem komme ich zumindest handschriftlich besser „in den Flow“. Da ja alles, was ich von Hand schreibe, „nur“ Notizen sind, haftet ihnen nichts Endgültiges an. Handschrift ist bei mir von jeher etwas Konzepthaft-Kreatives. Also fange ich leichter an. Ich habe mit dem Füller in der Hand keine Angst vor dem leeren Blatt Papier – im Gegenteil. Mittlerweile ist es mir sogar gelungen, diese gedankliche Leichtfüßigkeit auf PowerPoint und WordPress zu übertragen. Aber ihren Ursprung hat sie beim Notizblock. Und by the way, Ihr lieben Digital Officers dieser Welt: Was, glaubt Ihr, ist ein schnell mit Gedanken gefülltes und später angereichertes Blatt Papier? Richtig, ein so genannter „Sprint“ und damit etwas Hochagiles. Denn das ist das dritte Phänomen bei der Handschrift: Wenn man die eigenen (notierten) Gedanken später durchliest, fallen einem weitere ein. Unter uns Füller-Spezialisten gibt es dann eine interessante Technik: Wenn ich eine B- oder M-Feder einfach umdrehe, kann ich in dünnster EF-Stichbreite weitere Gedanken ankritzeln. Das auf diese Weise mehrfach vollgeschriebene Blatt sieht am Ende aus, wie ein Shooting für Paperlike oder ReMarkable – alles übrigens Software-Lösungen bzw. Devices, die genau diesen (handschriftlichen) Effekt versuchen ins Digitale hinüberzuretten.
Und am Ende ist das Papier eben ein haptisches und auch sonstwie sensorisches Erlebnis. Zugegeben, das ist sehr individuell. Aber der Spaßfaktor in der Beschäftigung mit Gedanklichem und ja, auch Abstraktem, ist bei mir halt vor allem gegeben, wenn Papier und Stifte im Spiel sind.
Handschrift und Digitales gekonnt kombinieren
Was spricht dagegen, handschriftliche Notizen später zu digitalisieren? Handelt es sich um brauchbare Gedanken, ist es doch keine „Verschwendung“ durch das Abtippen noch einmal Zeit darauf zu verwenden. Nicht selten wird das Gekritzel zur Keimzelle einer durchdachten Präsentation oder eines schlüssigen Konzeptpapiers. Bei Protokollen, die man selbst in der Regel nicht nochmal durchliest, gebe ich natürlich recht: das reicht, wenn man das sofort digital macht. Wobei „man“ in diesem Fall eine KI ist. Die „Abstracts“, die Copilot nur wenige Minuten nach einem Call liefert, sind inzwischen echt brauchbar geworden.
Apropos KI: Sie lässt sich vorzüglich nutzen, um handschriftlich Erarbeitetes zu initiieren, zu ergänzen oder zu challengen, wie man so schön sagt. Es gibt schon die ersten Tools, die sogar das Foto aus meinem Notizbuch in Digitales verwandeln.
Noch ein Aspekt: Digital und „distraction free“ gehen ja nicht immer Hand in Hand. Für manche Menschen überhaupt nicht. Und das ist dann nicht besonders kreativ. Hier scheint in den letzten Jahren eine solvente und interessante Zielgruppe gewachsen zu sein für digitale Devices, die wirklich NICHTS anderes können als zu schreiben. Da ist dann der Schritt „zurück“ zur Handschrift auch nicht mehr weit.
Zum Schluss: Ich will niemanden überzeugen, von Hand zu schreiben. Ich will aber bitteschön auch nicht als „Analogiker“ im Sinne von „Unverbesserlicher“ hingestellt werden, wenn ich für mich entschieden habe, dass ich mit einem meiner 90 Füllhalter und einem Block guten 115-Gramm-Papier kreativer bin als mit einem iPad in der Hand.

Schreibe einen Kommentar