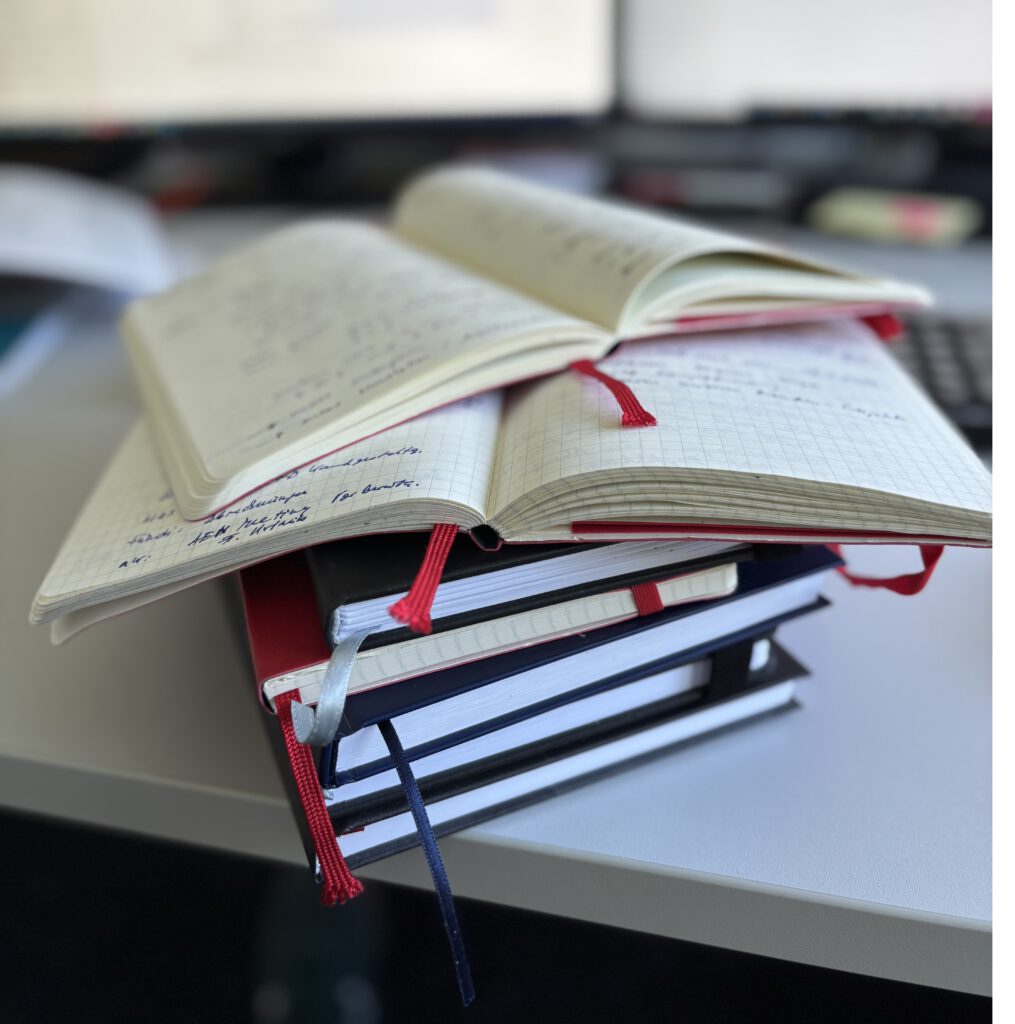Eine kleine biographisch gefärbte Skizze, die deutlich macht, warum jemandem an diesem „Tag der deutschen Einheit“ überhaupt nicht zum Feiern zumute ist. Allerdings: der Weg zu diesem Zustand verlief wellenförmig.

Ein bisschen schaue ich auf diesen Feiertag wie ein Kosmonaut auf die Erde (darüber lese ich gerade in dem Roman „Umlaufbahnen“): Man blickt mit dem Gefühl tiefer Verbundenheit und ja, fast Liebe, auf diesen fragilen Planeten hunderte Kilometer weit unten und kann andererseits nicht fassen, wegen welch nichtiger Probleme sich deren Bewohner an die Gurgel gehen.
Ich will in ein paar Erinnerungen schwelgen, wie das Leute in meinem gesetzten Alter so gerne tun. Und ich will sie nicht mit zynischen Gedanken über die fünf AfD-Hochburgen-Bundesländer anreichern. Naiver Historismus ist also angesagt, oder um es mit Ranke zu sagen: „zu zeigen, wie es eigentlich gewesen“.
Den Mauerfall verpennt
Am 9. November 1989 erhielt ich einen Anruf von meiner damaligen Freundin, den ich verpasste. Ich studierte in Tübingen, sie wohnte bei ihren Eltern in der Nähe meines Geburtsortes. Ich lebte zwar nicht in einem Wohnheim, aber in einem Apartmenthaus mit mehreren Studentinnen und Studenten, die sich einen Telefonapparat teilten. Der stand auf dem Flur – neben einem Notizbuch, in das man eintragen konnte wer in Abwesenheit von wem angerufen worden war. Ein paar Wochen zuvor hatte ich mit meiner Freundin einen eher unerfreulichen (letzten) gemeinsamen Urlaub in Griechenland verbracht. Dort sahen wir, dass die Menschen jeden Abend gebannt vor dem Fernseher saßen und die politische Berichterstattung verfolgten. Da wir schon vor unserer Abreise mitbekommen hatten, dass die Situation in der Prager Botschaft und die Flucht der DDR-Bürger nach Ungarn sich zuspitzte dachten wir: „Wow, das ist außergewöhnlich, dass die Griechen sich so für die deutsche Politik interessieren.“ Als wir dann einmal in einem Restaurant saßen, in dem ein Fernseher lief und genauer hinsahen, merkten wir, dass wir uns getäuscht hatten. Es ging, na klar, um eine griechische Parlamentskrise.
Am 9. November wollte mir meine Freundin mitteilen, dass die Mauer gefallen sei. Ich muss im wahrsten Sinne des Wortes abwesend gewesen sein. Eine Nachbarin – die übrigens heute meine Frau ist – notierte die Nachricht in unserem kleinen Heft. Sie sagte mir später, dass sie sich gewundert habe, dass mir meine Freundin nicht zugetraut hatte, diese Nachricht selbst herauszubekommen. Als ich von wo auch immer zurückkam und die Notiz las, schaltete ich den Fernseher an und verfolgte die Berichterstattung. Meine Freundin rief ich nicht zurück. Das Notizbuch hat sich leider nicht erhalten – was schade ist. Denn diese Eintragung würde ich heute einrahmen.
Wo ich die Stunden davor verbracht hatte, weiß ich leider nicht mehr. Bei meinem Freund und Kommilitonen A.R. war ich jedenfalls nicht. Denn der war an dem Tag bei gemeinsamen Freunden in Göttingen. Und brach bei der ersten Nachricht vom Mauerfall hektisch von Göttingen aus mit seinem auberginefarbenen Steilheck-VW-Polo ins Zonenrandgebiet auf und schwelgte an irgendeinem Grenzübergang in der Trunkenheit dieser Nacht. Er ist inzwischen Geschichtsprofessor (was ich ursprünglich auch mal werden wollte) und hat Bücher geschrieben, in denen es auch um die deutsche Einheit geht. Vermutlich hält er gerade in diesem Augenblick irgendwo eine salbungsvolle Festrede, möglicherweise gewürzt mit ein paar provokativen Spitzen gegen die aktuelle linksliberale Kulturdominanz.
Einheits-Skeptiker
Apropos linksliberal. Das war ich damals. Sehr sogar. Und ich wäre schon allein deshalb nicht freudetrunken mit an die Zonengrenze gefahren, weil die Maueröffnung sehr wenig euphorische oder nationale Gefühle in mir auslöste. Ich hatte die DDR (die ich aus familiären Gründen kannte, da meine beiden Eltern aus Dresden stammten) längst als eigenständigen deutschsprachigen Staat akzeptiert. Wenn, dann freute ich mich, dass die Menschen dort (darunter ja auch einige Verwandte von mir) nun die Chance haben würden, endlich zu reisen und in ihrem Land das Ruder selbst in die Hand zu nehmen für ein modernes, demokratisches politisches System. Der Gedanke an eine „Wiedervereinigung“ mit der DDR kam mir genauso abwegig vor wie die Vorstellung eines Zusammenschlusses mit Österreich oder der Schweiz. Als in den Wochen und Monaten nach dem Mauerfall diese Tendenz in westlichen Medien (ich hatte ein Studentenabo der FAZ) immer lauter wurde und dann noch ein von mir nicht besonders respektierter Bundeskanzler einen 5-, 7-, oder 10-Punkte-Plan vorlegte mit dem Ziel einer „Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion“ zwischen der BRD und der DDR, da dachte ich, dass das alles in die falsche Richtung läuft. Ich war damals, das sei unumwunden gestanden, komplett auf der Linie von Günter Grass und Oskar Lafontaine. Ich fand auch die Frage des letztgenannten ziemlich berechtigt (in meiner Erinnerung war er damals sogar Kanzlerkandidat), ob man denn nicht mal durchrechnen wolle, wie viel so eine Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion überhaupt koste und ob man das ohne zusätzliche Belastungen überhaupt finanziert kriegt. Ich erwog mehrfach, mein FAZ-Studentenabo zu kündigen (tat es aber nicht).
Das Feuerwerk
Am Ende hatte ich andere Probleme, nämlich die Hochphase meines Geschichts- und Literaturstudiums und die Frage, wie ich aus der Beziehung mit meiner Freundin (die mit dem Anruf von oben) raus und in eine Beziehung mit meiner Nachbarin (die mit der Anrufnotiz von oben) reinkommen könnte. Letzteres gelang mir im Laufe des Frühjahrs und Sommers 1990 und so „erwischte“ mich der 3. Oktober als noch einigermaßen frisch verliebter Jungspund, der sich von inzwischen vielfach erfolgten Diskussionen – nicht zuletzt mit meinem damals schon stramm nationalkonservativ ausgerichteten Freund und Kommilitonen A.R. – vermutlich hatte gnädig stimmen lassen im Hinblick auf die deutsche Einheit. Jedoch nutzte ich bewusst nicht den Begriff „Wiedervereinigung“, da mir der zu sehr nach Revision roch. Und mir ist noch gut in Erinnerung, wie sehr mir das Zögern des von mir nach wie vor verachteten Kanzlers missfiel, als es um die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze ging. Und für welchen Glücksfall ich den damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker hielt, der in meiner Erinnerung mehr als einmal vorpreschte und diplomatische Selbstverständlichkeiten zumindest publizistisch aussprach, während der Kanzler sich in sibyllinisches Schweigen hüllte und plötzlich wieder sehr zauderlich war. Ich will gar nicht spekulieren, ob er das tat, um den damals noch sehr präsenten Vertriebenenverbänden zu gefallen.
Den Abend des 3. Oktober 1990 habe ich dennoch als sehr schön in Erinnerung. Wir aßen zu Abend bei einem befreundeten Pärchen, mit dem wir dann in die Tübinger Innenstadt und hinauf zum Schloss gingen, um von dort aus das Feuerwerk anzuschauen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das von den städtischen Behörden organisiert war oder es wie zu Silvester an den Tagen zuvor Böllerkram zu kaufen gegeben hatte (vermutlich eher letzteres). Wir jedenfalls standen wie zu Silvester mit einer Flasche Sekt an den jahrhundertealten Mauern des Tübinger Schlosses und prosteten uns fröhlich zu. Irgendwo in der Stadt war vielleicht der spätere OB dieser Stadt, Boris Palmer als blutiger Erstsemester auch unterwegs und schaute gebannt in denselben Himmel wie wir – und gemeinsam in eine ungewisse Zukunft.
Glücksritter oder Idiot?
Die Euphorie kam dann doch noch, ein bisschen zumindest. Immer häufiger rechnete ich mir zusammen mit meinem Freund und Kommilitone A.R. aus, dass es doch im Wissenschaftsbetrieb nun mächtig „Zug im Kamin“ geben müsse, wenn erstmal alle marxistischen Geschichtsprofessoren abgewickelt und durch Privatdozenten (aus dem Westen) ersetzt würden. Mindestens eine Assi-Stelle müsste doch dann auch für uns frei werden. Für unsere Zukunft rechneten wir uns ziemlich schamlos eine Professur wenigstens in Greifswald aus – mit hohem Freizeitwert angesichts der Nähe zur Ostsee. „See you in Greifswald“, war ein nur insgeheim spaßhaft gemeinter Gruß, den wir uns damals oft zuriefen oder schrieben. Offiziell verkündete ich in launigen Runden, ich sei bereit, in dem Moment in den Osten zu gehen, in dem die Versorgung mit Nutella dort gewährleistet sei. Radioaktivität, belastetes Leitungswasser, Kohleöfen und Etagenklos seien mir wurscht. Auch das nur ein halb scherzhaft gemeinter Witz.
Denn das sollte schneller kommen, als gedacht. Mein Doktorthema siedelte ich im einstigen Königreich Sachsen an. Ich wollte ein dringendes Forschungsdesiderat zur dort besonders krassen „Reaktion“ nach der Revolution von 1848/49 füllen. Anfang 1992 reiste ich zur Vorbereitung und für Vorab-Recherchen zum ersten Mal nach Dresden, wo ich für ein paar Tage bei meiner Großmutter väterlicherseits unterkam. Und ich muss sagen: Als ich an der Stelle vorbeifuhr, an der früher diese extrem nervigen und strengen Grenzkontrollen für westliche Besucher erfolgten, die ich zuletzt 1986 über mich hatte ergehen lassen, erwischte es mich emotional recht intensiv. Mir traten die Tränen in die Augen. Erst hier, beim Anblick der stillgelegten Grenzübergänge hatte ich ein Gefühl dafür, was Freiheit bedeutete – und zwar auch meine Freiheit. Und in meinem Kopf kreisten Gedanken, wie und in welcher Form ich mich in den Einheitsprozess einschalten könnte. Diese Gedanken kreisten umso mehr, als ich bei den nach 1992 noch häufiger stattfindenden Archivreisen die Aufbruchstimmung in Dresden mitbekam. Deutlich in Erinnerung ist mir, mit welchem Elan, zwei junge Postler ein Postamt „schmissen“, das optisch, haptisch und olfaktorisch noch reinste DDR war. Aber die beiden machten das auf eine wirklich mitreißende Art, die Pragmatismus mit Effizienz und Freundlichkeit paarte. Ich dachte damals: Wenn das alles so läuft hier, dann wird das ein echter Gewinn. Das blieb vorerst meine Überzeugung, auch wenn ich die ersten Gruselgeschichten über westliche Glücksritter, die Treuhand sowie zusammenbrechende Ex-Kombinate schon kannte.
Irgendwann lernte ich Familie P. kennen – ein wirklich äußerst nettes, aufgeschlossenes Rentner-Paar, das mich für meine so etwa drei Wochen andauernden Archiv-Rechercheaufenthalte beherbergten. Wir diskutierten sehr oft – wobei diskutieren vielleicht falsch ist, da wir eigentlich einer Meinung waren mit einer positiven Einstellung zur Einheit. Die beiden vermittelten mir viele super-interessante Beispiele aus einer besonderen Perspektive (sie gehörten einer katholischen Minderheit an, waren tatsächlich auch sehr gläubig, und hatten das geerbte Mehrfamilien-Altbau-Haus, in dem sie lebten, als Privatbesitz durch die ganze Zeit der DDR-Zeit „gerettet“, trotz vielfacher Schikanen). 1994 nahm ich an einem Seminar teil, bei dem es auch eine Diskussionsrunde mit Heinz Eggert gab, dem damaligen Shootingstar der sächsischen Landespolitik. Ich erinnere mich an einen unkonventionellen, authentischen, furchtlosen Mann, der von zwei Sicherheitsbeamten und einem sehr jungen, sehr rothaarigen Assistenten begleitet wurde (letzterer sollte ihn ein paar Monate später mit sexuellen Missbrauchsvorwürfen zu Fall bringen). Ich erinnere mich noch an eine naive Frage, die ich stellte: Warum sich die ostdeutschen Politiker aller Parteien, und ausdrücklich nannte ich auch den Namen von Angela Merkel, nicht etwas lauter in die gesamtdeutsche Politik einbrachten. Ihr hemdsärmeliger Stil sei doch „für uns alle attraktiv“. Er lächelte mitleidig und zuckte die Schultern.
Die Abstoßung
1997 bewarb ich mich mit einer fast fertigen Diss. auf eine Stelle an einem landeshistorischen Duodez-Institut in Dresden, das zwar fern der Uni war, aber (kommissarisch) von deren Professoren geleitet wurde. Einer davon verarschte mich gleich direkt zum Einstieg, weil er mir falsche Versprechungen über die Fortsetzung meiner zunächst auf ein Jahr befristeten Anstellung machte (insgeheim hatte er einen Vertrag mit meiner Nachfolgerin schon unterzeichnet). Ahnungslos wie ich war, mietete ich mir eine Wohnung in Dresden und wollte eigentlich auch meine Freundin nachziehen lassen – und bin bis heute froh, dass das nicht geklappt hat. Sie hatte ein einziges Vorstellungsgespräch bei einem „Chef“, der schon bei diesem Termin recht anzügliche Andeutungen gemacht hatte. Meine Kollegen waren nicht besonders nett. Sie waren auch nicht direkt unfreundlich. Sie zeigten nur ziemlich deutlich, dass über das kollegiale Pflichtprogramm hinaus wenig Verbindung da war. Und null Interesse. Ich hatte zwar auch noch Kontakt zu meiner Familie und zur einstigen Gastfamilie P., aber Dresden kam mir jetzt verändert vor. Es waren zum einen durchaus schon Neonazis im Stadtbild präsent, ich hatte zudem immer öfter auch den Eindruck, gegängelt zu werden. Es gipfelte in einer Straßenbahnfahrt, als bei einer Fahrkartenkontrolle herauskam, dass unsere (korrekt entwerteten) Sammel-Einzelfahrscheine abgelaufen waren. Mir war nicht bewusst, dass Fahrscheine ein Ablaufdatum haben können, aber die Kontrolleure zerrten uns förmlich an einer Haltestelle hinaus in ein Büro, wo wir eine Art Protokoll mit Schuldeingeständnis und Strafmandat unterschreiben mussten. Das war Schikane, wie ich sie schon als DDR-Besucher erlebt hatte. Mein Kontakt beschränkte sich zunehmend nur auf andere „Wessis“ bzw. Expats. Unterhaltungen mit den „Ureinwohnern“ wurden monothematisch. Von deren Seite ging es, mal ganz direkt, mal auch mäandernd, um das Thema Geld, konkret um die Frage, wie viel ich verdiene und warum ich als Westdeutscher in Dresden „unseren Leuten“ eine wertvolle Stelle wegnehme.
Der Rückzug
Ja, ich gebe es zu: Der Anbruch des Jahres 1999 mit der Rückkehr aus Dresden war ein bedeutender Einschnitt in meinem Leben, den ich lange (fälschlicherweise) als Niederlage verbucht habe. Mit dem Osten kehrte ich auch der Wissenschaft den Rücken. Und beides sehr konsequent, was auch bedeutet: Ich hatte (und habe) beides einfach satt. Der private und familiäre Kontakt zu den Menschen „drüben“ brach ab – teils demografisch bedingt. Kanzlerin Merkel nahm ich schon gar nicht mehr als Ostfrau wahr, „Frische“ und „Hemdsärmeligkeit“ war in ihrem Regierungsstil ohnehin nie zu erkennen. Belanglose, verlorene Jahre letztlich. Ich begab mich nach und nach in meine „Umlaufbahn“-Perspektive. Und die geht heute so: Die Welt brennt, die Demokratien sterben, der Kapitalismus schnappt komplett über und mit ihm die soziale Ungleichheit. Es gibt wieder militärische Bedrohungen in Europa, eine hochleistungsfähige KI in der Hand skrupelloser und unkontrollierter Tech-Milliardäre trifft auf eine in ihrer Mehrheit dumpfe und ungebildete Bevölkerung. Und wir wollen uns tatsächlich noch über die deutsche Einheit freuen? Die uns null Vorteile verschafft bei der Bewältigung aller anstehenden Probleme – eher im Gegenteil. Wie provinziell kann man sein?
Nein, lasst uns das Thema abhaken. Ich will die deutsche Einheit auch nicht rückgängig machen. Es gibt sie halt. So wie Tauben in einer Großstadt oder Erkältungen im Winter. Kein Grund zur Freude oder zum Feiern. Kein Feuerwerk, keine Festreden. Und gerne kann auch der Feiertag wieder weg.